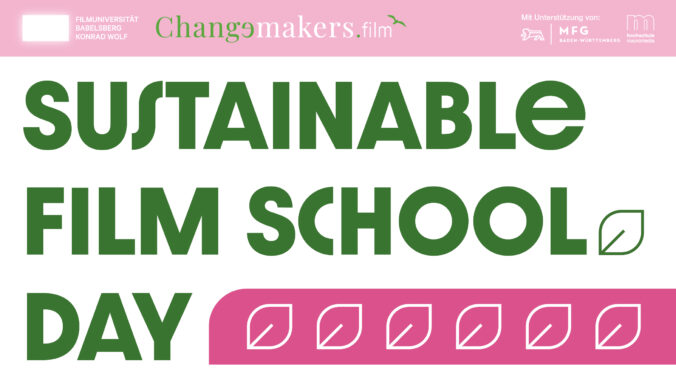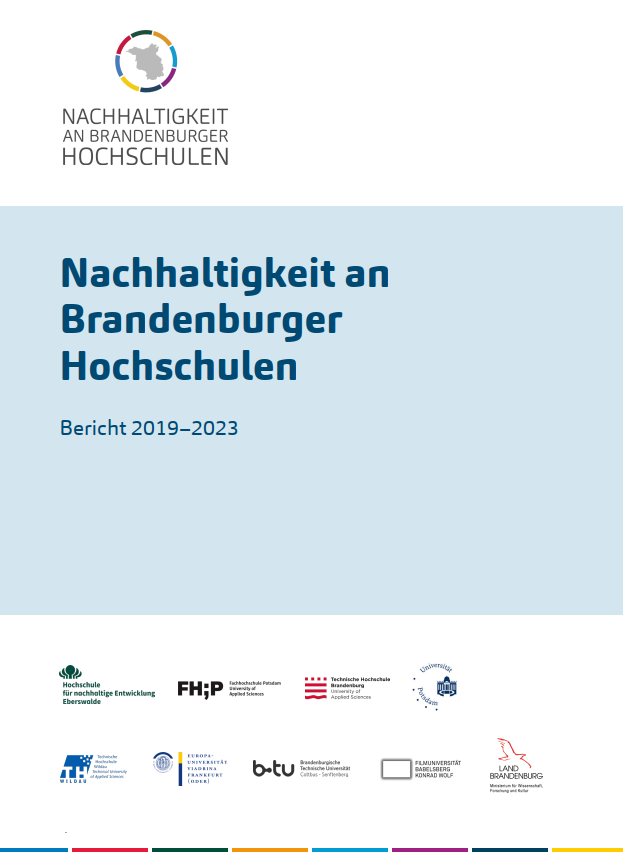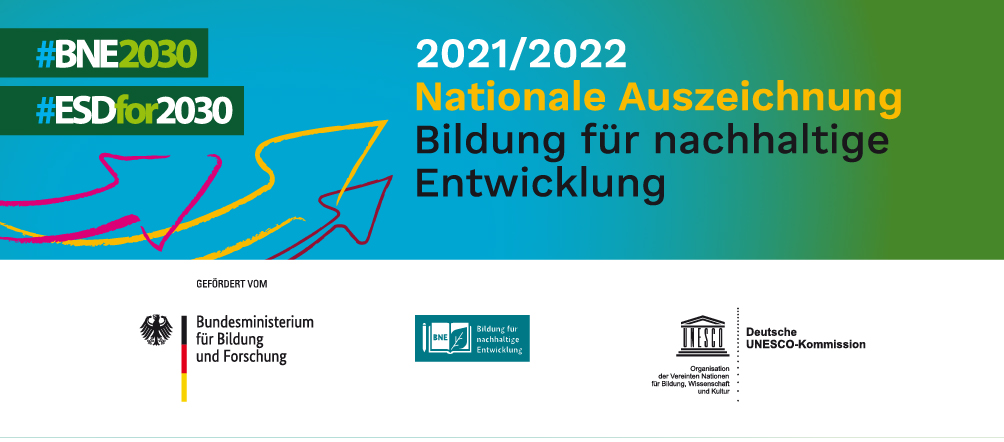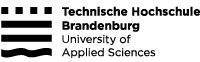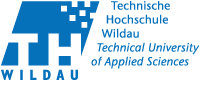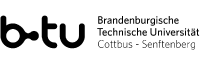Aus den Hochschulen in die Region – Nachhaltigkeitstransfer in Brandenburg







Das fachübergreifende Modul im Sommersemester 2025 war eingebettet in das Verbundprojekt InNoWest – Einfach Machen! Dieser Verbund der drei Hochschulen in Nord-West-Brandenburg (HNE Eberswalde, TH Brandenburg und FH Potsdam) trägt wissenschaftliche Erkenntnisse ein und identifiziert Bedarfe und Impulse aus der Praxis, um gemeinsam mit den Akteur*innen aus der Region Ideen und Projekte zu entwickeln und umzusetzen.
Das Modul gliedert sich in das Ziel der AG Nachhaltigkeit an Brandenburger Hochschulen ein, fachübergreifende Hochschullehre in Brandenburg zu fördern.
Wie könnten die Elbe und ihre Lebensgemeinschaften mit uns kommunizieren, welche Geschichten würden sie uns erzählen? Welche neuen Erfahrungen können wir in der Begegnung mit dem Fluss schaffen? Welche anderen Perspektiven auf den Fluss und seine Gemeinschaften können wir einnehmen?
Gemeinsam wurden neue Perspektiven auf Nachhaltigkeit am Beispiel der Elbe für und mit Menschen in der Region eröffnet. Kollektive Lernprozesse der Studierenden und weiteren Beteiligten wurden durch Kommunikation angestoßen: vielschichtige Narrative wurden durch Texte, Karten, visuelle Studien, Daten, Fotografien, Illustrationen entwickelt und damit eine Print-Publikation konzipiert, die die Ergebnisse des Moduls aufzeigt und zugleich als Prüfungsleistung gilt. Der Weg dahin:
- Im Modul wurden gemeinsam mit Partner*innen aus der Region, Fragestellungen aus den Bereichen Ökologie, Partizipation oder Demokratie bearbeitet. Sie Studierenden beschäftigten sich konkret mit
- dem Umgang mit der invasiven Wollhandkrabbe in der Elbe,
- Brücken und Grenzen am Flussverlauf in Wittenberge und der Region,
- Mythen und Legenden rund um die Elbe,
- dem Flussbett und
- damit, welche Rolle die Gerüche der Elbe für Mensch und Natur spielen
- In Gruppen, die jeweils zu diesen Bereichen arbeiteten, wurden Perspektiven und Zusammenhänge recherchiert, Feldübungen an der Elbe und ihrer Umgebung durchgeführt, mit interdisziplinären Methoden und Materialien experimentiert, eigene Beobachtungsinstrumente gebaut oder in einen lebendigen Austausch mit Akteur*innen aus der Region gegangen.
- Als Produkt des Seminars wird in Kürze eine Broschüre zu den Ergebnissen entstehen.
Kooperationspartner*innen: Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe; Elbgarten Wittenberge (Gemeinschafts- und Bildungsraum); Demokratieforum Prignitz; Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung (LKJ); Naturwacht Brandenburg; BUND